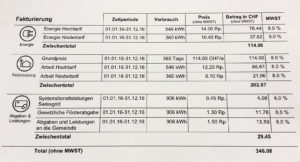Natürlich bin ich glücklich, in meiner Garage über eine Ladestation zu verfügen und so die Batterie des BMW i3 jeweils für kürzere bis mittlere Distanzen – im Winter reicht es für 100 bis 150 km – aufladen zu können. Zwar funktionierte diese von BMW gelieferte und von Alpiq montierte Apparatur vorerst nicht und musste ausgewechselt werden, doch seit Mitte Februar kann ich damit zuverlässig laden.
Weit komplizierter ist es, meine Batterie an einer öffentlichen Ladestation aufzuladen. Erstens gibt es immer wieder Ladestationen, die von fetten Benzin-Autos als normale Parkplätze genutzt werden (kann man die eigentlich büssen?). Zweitens finde ich bei renommierten BMW-Garagen aus der noblen Emil Frey-Gruppe zwar die für E-Mobilität reservierten grünen Park-Felder, doch fehlt die eigentliche Ladeinfrastruktur.
Freude bereiten mir demgegenüber einzelne kleinere und grössere Autogaragen von Renault und anderen Automarken, bei denen ich ohne bürokratische Formalitäten gratis die Batterie wieder auf einen Höchststand bringen kann. Grosse Schwierigkeiten habe ich demgegenüber mit einzelnen Elektrizitätswerken, welche zwar eine Ladestation installiert haben (wohl primär, um im Geschäftsbericht des EW ein schönes Foto zeigen zu können), doch gleichzeitig die Nutzung für den normalen E-Fahrer verunmöglichen, weil sie eine separate Card kreiert haben. Kopfschütteln löst dies für mich beispielsweise im Tourismuskanton Tessin aus, wo man für die Ladestationen des kantonalen Elektrizitätswerk AET eine spezielle Card braucht: hier wird in Einheimischenkategorien gedacht und nicht in den Dimensionen der vernetzten, kantonsübergreifenden Mobilität.
Im vergangenen Mai habe ich als BFE-Direktor letztmals eine „Landsgemeinde“ all jener Organisationen und Firmen eröffnet, welche in die Ladeinfrastruktur investieren wollten. Ich habe sie damals motiviert, nun diese Chargingstationen zu realisieren. Heute würde ich aufgrund meiner Nutzererfahrungen eine andere Rede halten: ich würde verlangen, dass sie sich zuerst auf eine gemeinsame Software, eine in der ganzen Schweiz gültige Card sowie ein einfaches Abrechnungssystem einigen, bevor sie einen Franken in die Hardware investieren.
Denn heute sind verschiedenste Gruppen sowie Firmen wie move oder easy4you und andere mit je eigenen Konzepten auf dem Markt. Als Nutzer müsste ich bei all diesen angemeldet sein, teils eine jährliche Grundgebühr bezahlen und daneben hoffen, dass jene Stationen, die ich anwähle, dann auch funktionieren. Selbstverständlich haben diese Organisationen je ein Callcenter, doch sind die Leute sprachlich teils nicht bewandert (sprechen eher schlecht Deutsch), teils primär technisch orientiert und teils haben sie keinen direkten Zugang zu den einzelnen Ladestationen, weil irgendein ein EW dazwischen noch eine separate Einstellung vorgenommen hat, welche nur ihm den direkten Kontakt mit dem Kunden möglich macht.
Höhepunkt meines diesbezüglichen Frustes war im Februar der Besuch einer Autobahnraststätte im schweizerischen Mittelland, die gemäss App über eine Schnellladestation verfügt Ich ging zum entsprechenden schön designten Platz und merkte, dass ich ohne die spezielle Card dieser Organisation nicht einfach zu Strom kommen würde. Das Callcenter wies mich dann darauf hin, dass ich beim nahen Kiosk eine Card ausleihen könne. Am Kiosk wurde mir mitgeteilt, dass man grundsätzlich 10 Franken für die Nutzung der Card bezahlen müsse, unabhängig davon, wieviele Kilowattstunden man tanke. Zusätzlich müsse ich ein Pfand abgeben. Ich reichte also 100 Franken über den Tisch und sagte, dann seien die restlichen 90 Franken eben das Pfand.
Aber das wurde von der Verkäuferin nicht akzeptiert, weil die 10 Franken nicht etwa in die allgemeine Kioskkasse kommen, sondern in ein separates Couvert gesteckt werden, auf dem der Name des betreibenden EWs steht (des Sängers Höflichkeit gebietet es mir, den Namen nicht zu nennen). Wenn nun dort noch 90 Franken für mein Pfand reingesteckt würden, dann würde das die totale Verwirrung stiften. Ich entschloss mich in der Folge, meine Hausschlüssel als Pfand zu hinterlassen. Nachdem ich weitere zwei Telefonate mit dem Callcenter hinter mir hatte, weil einer der Stecker nicht richtig angeschlossen war, konnte ich dann endlich mit dem Schnellcharger starten…
In Luxemburg hat der zuständige Energiedirektor Tom Eischen diesen Wildwuchs vorausgesehen und in seiner pragmatischen Art den Aufbau der E-Mobilität-Ladeinfrastruktur zu den Aufgaben des nationalen Stromnetzbetreibers erklärt. Da ist alles einheitlich, netzmässig klug aufgebaut und erst noch sehr kundenfreundlich, da gibt sich keiner der Illusion hin, mit diesen Säulen das grosse Geld machen zu können. Auch in der Schweiz ist noch niemand mit diesen Chargingstationen reich geworden und alle suchen noch ein Businessmodell, gemäss dem sich das Ganze je rechnen könnte.
Ich habe grosse Sympathie für Andreas Burgener, den Direktor von autoschweiz, der vor einiger Zeit verlangte, dass der Bund beim Aufbau der öffentlichen E-Ladeinfrastruktur deutlich mehr Vorgaben machen sollte. Denn das heutige System der öffentlichen Ladestationen ist chaotisch entstanden, nicht strategisch ausgerichtet und total benutzerunfreundlich – so werden wir der E-mobilität in der Schweiz nicht zum Durchbruch verhelfen.